... newer stories
Sonntag, 1. August 2021
Fenstergeschichten
laghbas, 00:14h
DER ROTE GEBRAUCHTWAGEN
Vier arabisch erscheinende Menschen, mit Bärten, alle irgendwie dunkel, alle schnieke und schick, wie frisch geölt, Typ FEMINIST, bekommen von einem fünften arabisch erscheinenden Menschen den neuen Elektro-Roller gezeigt.
Geiles Teil!
Mit Vorderlicht, unabhängig aktivierbar. Mit richtig hellem, rotem Rücklicht, Schutzblechen. Windschutz unten. Schwarz.
(Ich will auch einen E-Roller!).
Irgendwann kommt von rechts ein sechster hinzu (arabisch erscheinender Mensch, nicht etwa Elektro-Roller).
Begrüßung: Blablabla. Gesten.
Distanzierte Rückenlage.
Wie die anderen halt.
Ein weiterer, den ich aber bereits erwähnt, und dergestalt mitgezählt habe, kehrt - von der anderen Seite, von schräg links - nur wenige Sekunden später von der ihm offenbar zugestandenen Probefahrt mit dem neuen technischen Gerät zur Gruppe zurück.
Er scheint befriedigt.
Irgendwie interessiert sich jetzt plötzlich niemand mehr für den E-Skooter, abgesehen vom Besitzer, der niederkniet und sich bemüht, die Aufmerksamkeit seiner Artgenossen ein letztes Mal auf die Besonderheiten seines neuen Flitzers zu lenken. Schließlich aber klappt er den Roller zusammen (wie praktisch!), klemmt ihn unter den Arm wie ein Surfbrett (wie cool!), und verbringt ihn in den Kofferraum seines leicht angegammelten, roten Gebrauchtwagens, dessen Marke exakt festzustellen ich bedauerlicherweise versäumt habe. Eventuell ein älterer Audi oder VW, oder so...
Etwas später: Jetzt ist Ruhe. Schätze, man ist noch zu einem abendlichen Event aufgebrochen.
Könnte auch ein älterer BMW gewesen sein.
THE END.
Nachtrag:
Es war ein Hyundai, und er war schwarz.
Vier arabisch erscheinende Menschen, mit Bärten, alle irgendwie dunkel, alle schnieke und schick, wie frisch geölt, Typ FEMINIST, bekommen von einem fünften arabisch erscheinenden Menschen den neuen Elektro-Roller gezeigt.
Geiles Teil!
Mit Vorderlicht, unabhängig aktivierbar. Mit richtig hellem, rotem Rücklicht, Schutzblechen. Windschutz unten. Schwarz.
(Ich will auch einen E-Roller!).
Irgendwann kommt von rechts ein sechster hinzu (arabisch erscheinender Mensch, nicht etwa Elektro-Roller).
Begrüßung: Blablabla. Gesten.
Distanzierte Rückenlage.
Wie die anderen halt.
Ein weiterer, den ich aber bereits erwähnt, und dergestalt mitgezählt habe, kehrt - von der anderen Seite, von schräg links - nur wenige Sekunden später von der ihm offenbar zugestandenen Probefahrt mit dem neuen technischen Gerät zur Gruppe zurück.
Er scheint befriedigt.
Irgendwie interessiert sich jetzt plötzlich niemand mehr für den E-Skooter, abgesehen vom Besitzer, der niederkniet und sich bemüht, die Aufmerksamkeit seiner Artgenossen ein letztes Mal auf die Besonderheiten seines neuen Flitzers zu lenken. Schließlich aber klappt er den Roller zusammen (wie praktisch!), klemmt ihn unter den Arm wie ein Surfbrett (wie cool!), und verbringt ihn in den Kofferraum seines leicht angegammelten, roten Gebrauchtwagens, dessen Marke exakt festzustellen ich bedauerlicherweise versäumt habe. Eventuell ein älterer Audi oder VW, oder so...
Etwas später: Jetzt ist Ruhe. Schätze, man ist noch zu einem abendlichen Event aufgebrochen.
Könnte auch ein älterer BMW gewesen sein.
THE END.
Nachtrag:
Es war ein Hyundai, und er war schwarz.
... link
David...
laghbas, 23:31h
... Wellington.
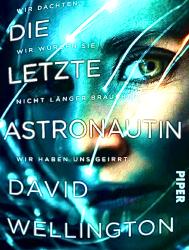
Die letzte Astronautin, The Last Astronaut, 2019.
SF-THRILLER mit hohem Dark-Fantasy und Horror-Anteil.
David Wellington, ?Die letzte Astronautin?, (?The Last Astronaut?, 2019).
Als nahe der Erde ein riesiges interstellares Objekt auftaucht, das sich bald als eine Art Raumschiff herausstellt, macht sich eine Mission auf den Weg, um das Phänomen zu erforschen.
Ein recht unterhaltsamer, jedoch auch zwiespältiger Genuss.
Stilistisch annehmbar, mit nett zusammengefügten Ideen, wenn auch hin und wieder sehr, sehr dicht an der Grenze zum Groschen- bzw. Rollenspielroman. Heißt: schnell zu lesen, zügig, simpel im Satzbau und dabei extrem sparsam im Gebrauch von Adjektiven und damit der ausführlicheren Anleitung der Leserfantasie. Was natürlich kein Manko sein muss, eher im Gegenteil, was aber auch bedeutet, dass der dann zwangsläufig schnell und hart wirkende Stil, wenn - wie in diesem Fall - übertrieben angewandt, deutlich zu Lasten der psychologischen Tiefe geht und einen sehr oberflächlichen Eindruck hinterlässt. Und wenn dann, von den dargebotenen Bildern und Inhalten her, zusätzlich noch todbringende Ranken (eine Variation der klassischen, in der Science-Fiction unsterblichen Tentakel) sowie Riesenwürmer mit rund kreisenden Zahnfräsen auf der Projektionsfläche erscheinen, dann fragt sich der anspruchsvolle Leser eben doch irgendwann, wohin er denn eigentlich seine alten Romanhefte verkramt hat.
Ganz unten ins Regal mit den Verpackungen und, teilweise, Büromaterialien, in meinem Fall.
Alles nicht wirklich neu, manche Ideen ohne Zweifel überzeugend, wirklich phantastisch und bleibenden Eindruck hinterlassend (der ?Wald der Handbäume? beispielsweise), manche aber auch, ob bewusst oder unbewusst reproduziert bleibt offen, bloße, in den Plot reinverwurstete Versatzstücke der klassischen, literarischen und vor allem filmischen Phantastik.
So findet sich beispielsweise eine der Grundideen bereits in "Die phantastische Reise" (Richard Fleischer, USA 1966), hier aufgemöbelt durch eine kräftige Portion ?Alien? (Ridley Scott, USA 1979) sowie, was Ground Control, den Missionsleiter auf der Erde und die Darstellung der NASA angeht, einen Schuss ?Unternehmen Capricorn? (Peter Hyams, USA 1977). Und auch im Einzelnen erleben wir immer wieder bereits altbekannte Motive. Von den bereits erwähnten Riesenwürmer, die - zumindest in der Szene, in der sie eingeführt werden - stark an Frank Herbert?s Sandwürmer auf Arrakis erinnern (wie auch immer sie den Sprung von einem Universum in das andere auch geschafft haben mögen), bis hin zu einer kosmologischen Auflösung des menschlichen Einzelbewusstseins in bester Robert-Silverberg-Manier.
Nun ist eine Anlehnung an bereits ausgearbeitete Ideen der Phantastik, und hier im Besonderen der Science-Fiction, zwar nicht grundsätzlich zu verurteilen (schließlich stehen wir alle auf den Schultern von Riesen), eine zu unreflektierte Übernahme bereits bekannter Inhalte jedoch sollte, alleine um der Seriosität willen und um Irritationen zu vermeiden, immer zwingend von einer in den Text eingebauten Referenz begleitet werden.
Falls Sie die Vorbilder nicht kennen, Herr Wellington: eignen Sie sich mehr Grundlagen an, oder, falls Sie sich bewusst zu nahe an klassischen Werken der Phantastik bewegen, geben Sie Referenz!
Bevor wir nun tatsächlich zum Fazit kommen, sollte ich vielleicht - der Vollständigkeit halber - noch die leichten Logikschwächen, vor allem die in meinen Augen unzureichende psychologische Grundmotivation der Hauptprotagonistin, und den allgemein ziemlich oberflächlichen, nahezu klischeehaften Schnitt der Charaktere erwähnen.
Hiermit getan.
Trotz der erwähnten Schwächen ein durchaus lesbarer Roman mit einer zweifellos dramatisch gelungenen Story, die funktioniert und die Hand und Fuß hat. Kein großes, für das Genre wirklich bedeutsames Werk, aber doch eine leichte, schnelle Lektüre mit immer mal wieder spannenden und überzeugenden Momenten, geeignet für jeden Leser, der nicht unbedingt einen weitergehenden Anspruch auf psychologische und inhaltliche Tiefe oder gar genrerelevante Innovation erhebt.
Ein unterhaltsamer und zügiger SF-Thriller mit Dark Fantasy und Horrorelementen - nicht mehr, aber auch nicht weniger.
69 %
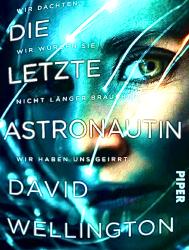
Die letzte Astronautin, The Last Astronaut, 2019.
SF-THRILLER mit hohem Dark-Fantasy und Horror-Anteil.
David Wellington, ?Die letzte Astronautin?, (?The Last Astronaut?, 2019).
Als nahe der Erde ein riesiges interstellares Objekt auftaucht, das sich bald als eine Art Raumschiff herausstellt, macht sich eine Mission auf den Weg, um das Phänomen zu erforschen.
Ein recht unterhaltsamer, jedoch auch zwiespältiger Genuss.
Stilistisch annehmbar, mit nett zusammengefügten Ideen, wenn auch hin und wieder sehr, sehr dicht an der Grenze zum Groschen- bzw. Rollenspielroman. Heißt: schnell zu lesen, zügig, simpel im Satzbau und dabei extrem sparsam im Gebrauch von Adjektiven und damit der ausführlicheren Anleitung der Leserfantasie. Was natürlich kein Manko sein muss, eher im Gegenteil, was aber auch bedeutet, dass der dann zwangsläufig schnell und hart wirkende Stil, wenn - wie in diesem Fall - übertrieben angewandt, deutlich zu Lasten der psychologischen Tiefe geht und einen sehr oberflächlichen Eindruck hinterlässt. Und wenn dann, von den dargebotenen Bildern und Inhalten her, zusätzlich noch todbringende Ranken (eine Variation der klassischen, in der Science-Fiction unsterblichen Tentakel) sowie Riesenwürmer mit rund kreisenden Zahnfräsen auf der Projektionsfläche erscheinen, dann fragt sich der anspruchsvolle Leser eben doch irgendwann, wohin er denn eigentlich seine alten Romanhefte verkramt hat.
Ganz unten ins Regal mit den Verpackungen und, teilweise, Büromaterialien, in meinem Fall.
Alles nicht wirklich neu, manche Ideen ohne Zweifel überzeugend, wirklich phantastisch und bleibenden Eindruck hinterlassend (der ?Wald der Handbäume? beispielsweise), manche aber auch, ob bewusst oder unbewusst reproduziert bleibt offen, bloße, in den Plot reinverwurstete Versatzstücke der klassischen, literarischen und vor allem filmischen Phantastik.
So findet sich beispielsweise eine der Grundideen bereits in "Die phantastische Reise" (Richard Fleischer, USA 1966), hier aufgemöbelt durch eine kräftige Portion ?Alien? (Ridley Scott, USA 1979) sowie, was Ground Control, den Missionsleiter auf der Erde und die Darstellung der NASA angeht, einen Schuss ?Unternehmen Capricorn? (Peter Hyams, USA 1977). Und auch im Einzelnen erleben wir immer wieder bereits altbekannte Motive. Von den bereits erwähnten Riesenwürmer, die - zumindest in der Szene, in der sie eingeführt werden - stark an Frank Herbert?s Sandwürmer auf Arrakis erinnern (wie auch immer sie den Sprung von einem Universum in das andere auch geschafft haben mögen), bis hin zu einer kosmologischen Auflösung des menschlichen Einzelbewusstseins in bester Robert-Silverberg-Manier.
Nun ist eine Anlehnung an bereits ausgearbeitete Ideen der Phantastik, und hier im Besonderen der Science-Fiction, zwar nicht grundsätzlich zu verurteilen (schließlich stehen wir alle auf den Schultern von Riesen), eine zu unreflektierte Übernahme bereits bekannter Inhalte jedoch sollte, alleine um der Seriosität willen und um Irritationen zu vermeiden, immer zwingend von einer in den Text eingebauten Referenz begleitet werden.
Falls Sie die Vorbilder nicht kennen, Herr Wellington: eignen Sie sich mehr Grundlagen an, oder, falls Sie sich bewusst zu nahe an klassischen Werken der Phantastik bewegen, geben Sie Referenz!
Bevor wir nun tatsächlich zum Fazit kommen, sollte ich vielleicht - der Vollständigkeit halber - noch die leichten Logikschwächen, vor allem die in meinen Augen unzureichende psychologische Grundmotivation der Hauptprotagonistin, und den allgemein ziemlich oberflächlichen, nahezu klischeehaften Schnitt der Charaktere erwähnen.
Hiermit getan.
Trotz der erwähnten Schwächen ein durchaus lesbarer Roman mit einer zweifellos dramatisch gelungenen Story, die funktioniert und die Hand und Fuß hat. Kein großes, für das Genre wirklich bedeutsames Werk, aber doch eine leichte, schnelle Lektüre mit immer mal wieder spannenden und überzeugenden Momenten, geeignet für jeden Leser, der nicht unbedingt einen weitergehenden Anspruch auf psychologische und inhaltliche Tiefe oder gar genrerelevante Innovation erhebt.
Ein unterhaltsamer und zügiger SF-Thriller mit Dark Fantasy und Horrorelementen - nicht mehr, aber auch nicht weniger.
69 %
... link
Donnerstag, 29. Juli 2021
Es ist...
laghbas, 19:23h
... echt gruselig, wer sich jetzt alles, betreffs der Frage nach Impfung oder Nicht-Impfung, als Arschloch/-*IN und/oder vollkommen empathieloser Psychopath/-*IN offenbart.
Ich, für meinen Teil, werde mir jeden Einzelnen dieser Unmenschen/-*INNEN merken.
Ich, für meinen Teil, werde mir jeden Einzelnen dieser Unmenschen/-*INNEN merken.
... link
Sonntag, 25. Juli 2021
Eine...
laghbas, 10:11h
... sensationelle, mitten aus den Arbeitsprozessen der aktuellen Fremdlerforschung herausgerissene Mitteilung von Prof. Dr. Höhner von der Universität Mainz, der mich in einer Mail wissen lässt, dass womöglich neue, strukturrelevante Muster und Einteilungen gefunden wurden.
Unter anderem gibt es erste Hinweise auf eine Art MYTHOLOGIE der Fremdler-Archive. Natürlich, so Dr. Höhner in seiner Nachricht an mich, beginnt die eigentliche Arbeit erst jetzt. Die Hinweise
müssen überprüft werden.
Ist der Zusammenhang stimmig?
Noch ist nichts offiziell, aber ich danke Prof. Höhner für seine anhaltende Bereitschaft, mich - was eventuelle Forschungsergebnisse betrifft - auf dem Laufenden zu halten und damit mein Buchprojekt weiterhin zu unterstützen.
V. Groß - Autor des Buchs "Die Fremdler-Archive - Buch I - Die Geschichte der Teloor", erschienen im Ring-Verlag Thorsten Stein, 2022/23.
***
Anm.:
Originalanlage am 04.07.21 - Post 24.07.21 - hochgezogen.
Unter anderem gibt es erste Hinweise auf eine Art MYTHOLOGIE der Fremdler-Archive. Natürlich, so Dr. Höhner in seiner Nachricht an mich, beginnt die eigentliche Arbeit erst jetzt. Die Hinweise
müssen überprüft werden.
Ist der Zusammenhang stimmig?
Noch ist nichts offiziell, aber ich danke Prof. Höhner für seine anhaltende Bereitschaft, mich - was eventuelle Forschungsergebnisse betrifft - auf dem Laufenden zu halten und damit mein Buchprojekt weiterhin zu unterstützen.
V. Groß - Autor des Buchs "Die Fremdler-Archive - Buch I - Die Geschichte der Teloor", erschienen im Ring-Verlag Thorsten Stein, 2022/23.
***
Anm.:
Originalanlage am 04.07.21 - Post 24.07.21 - hochgezogen.
... link
Samstag, 24. Juli 2021
Capone
laghbas, 08:38h
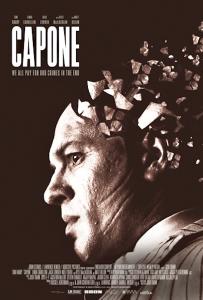
Capone, USA 2020
Regie: Josh Trunk
Ich liebe kontroverse Filme. Oft genug findet man unter den kontroversen die WIRKLICH großen Filme, die Rohdiamanten der Filmkunst, die den handwerklichen Status Quo aufbrechen, um neue, innovative Wege zu gehen, neue Ideen umzusetzen, eine neue Bildsprache zu entwickeln, und damit neue filmische Dimensionen zu eröffnen.
Im Falle von Capone gelingt dies aber leider nur teilweise.
Zwar ist der ambitionierte und höchst anspruchsvolle Versuch, den Josh Trunk mit CAPONE unternimmt, aller Ehren wert, und er ist auch keineswegs völlig misslungen. Die Idee ist klasse. Bilder und Tempo, Schauspiel und Atmosphäre sind prima. Woran es jedoch fehlt, ist eine wirkliche Geschichte, ein Drehbuch mit einer Story, die Ziel und Richtung hat, Dinge, die einer filmischen Darstellung Orientierung, Dramaturgie und Geschlossenheit verleihen.
Nebenbei: Das Argument des bewussten Einsatzes der Orientierungslosigkeit als Stilmittel greift an dieser Stelle nicht, weil ein Stilmittel, das dazu führt, dass der Film nicht mehr funktioniert, kein Stilmittel mehr ist, sondern ein handwerklicher Fehler.
:-)
Die Situation: AL CAPONE wird nach zehnjähriger Haft (wegen Steuerhinterziehung - ein Treppenwitz der Historie übrigens) entlassen und auf seinem Privatbesitz in Florida unter Hausarrest gestellt. Er ist schwer krank, die Haft hat ihn gebrochen und, nach zwei Schlaganfällen, in die Demenz gestürzt.
Josh Trunk's Film widmet sich dem letzten Lebensjahr des legendären, nahezu in mythologische Sphären verklärten Verbrechers (und ist damit auch Mythologiekritik).

Eins ist klar, selten war eine Struktur so einzig und alleine auf eine einzige Figur ausgerichtet. Ein Konzept, das man in diesem Fall durchaus als gelungen bezeichnen kann, weil CAPONE den Verdacht, einfach nur ein weiteres oscar- und starfixiertes Movie zu sein, unter Hardys großartiger, stoischer Verkörperung der Hauptfigur unmittelbar ad absurdum führt. Hardy's Dialogarbeit (obwohl man von DIALOG eigentlich kaum noch sprechen kann) beschränkt sich auf unartikuliertes Brummen und Knurren - ein gelegentliches, nahezu unverständliches Nuscheln und - ganz, ganz selten einmal - zumindest ansatzweise, klare Worte immer dann, wenn anfallartig Aggression auftritt. Dann wechselt die Hauptfigur ins Italienische (deutsche Untertitelung) und äußert sich laut und relativ klar. Aber auch Hardy's nonverbales Spiel kennt nur ein Minimum an Zuständen: das blöde, inhaltsleere Vor-sich-hin-Starren, die vollkommene Paralyse, den aggressiv-paranoiden Anfall und einen, zumindest emotional, minimalstisch aktiveren Modus in Form des passiv Erlebenden im ausweglosen Labyrinth seiner persönlichen Erinnerungen und Halluzinationen.
Das alles erweckt dabei, erstaunlicherweise, nie auch nur einen einzigen Moment lang den Eindruck, speziell auf Hardy und seine exaltierte Performance hin ausgerichtet oder konstruiert zu sein, sondern verbleibt stets als organischer Teil der filmischen Perspektive des in sich gefangenen Erkrankten. Hier ist, wiederum erfreulicherweise, nicht der Schauspieler der Star, sondern das Thema.
Denn - nicht zuletzt - ist CAPONE natürlich auch der Versuch einer überzeugenden Darstellung des inneren Erlebens im Zustand einer Demenz, und stellt dergestalt eine extrem kompromisslose, und deshalb wahrscheinlich auch gelungene, Konfrontation und Auseinandersetzung mit der Krankheit dar. Ich kenne keinen anderen Film, der das Thema so gnadenlos in all seiner nackten, grotesken Brutalität und Grausamkeit zeigt, ohne einen Ausweg, ohne Verniedlichung, berrührte Umschreibung oder falsche Empfindlichkeit.

Wie also dreht man einen ernsthaften Film, der rein in der Wahrnehmung und dem Erleben eines Demenzkranken verbleiben will?
Ein schwieriges Unterfangen, das es tatsächlich erfordert, an den Grenzen und Schnittlinien der Machbarkeit gewöhnlicher filmischer Umsetzung zu arbeiten. CAPONE versucht zu diesem Zweck konsequent alle realen und irrealen Szenen, oder Personen, den exakt gleichen Status zuzuerkennen, um damit Realität, Erinnerung, Haluzination und paranoide Wahngebilde filmisch so miteinander zu verschmelzen, dass ALLES, was geschieht, letztlich in Frage gestellt werden muss. Im Grunde kann man in CAPONE niemals sicher sein, ob überhaupt irgendetwas - oder irgendjemand - real ist. Im Prinzip könnte der gesamte Film auch ausschließlich aus den Fetzen und Fragmenten des dementen Erlebens der Hauptfigur bestehen, die, auf der ausladenden Terasse eines Anwesens in Florida, blöd, und mit, zunächst einer Zigarre, später einer abgebrochenen Möhre im Gesicht, leer und sinnlos in den Park starrt. Während Wirklichkeit, Erinnerung und Halluzination untrennbar sich verbinden, und kaum mehr Sinn ergeben.
Das ist, um das Wenigste zu sagen, ein äußerst interessanter Ansatz, auf den man sich allerdings einlassen können muss.
Das alles - ambitioniert genug - gelingt, funktioniert, macht den Film zu etwas Großartigem.
Wenn da nur nicht der Mangel an Dramaturgie, an Entwicklung, an einer echten Geschichte wäre.
Ganz klar ein gravierender Mangel des Drehbuchs, das sich in der Bebilderung der Demenzperspektive verliert und vergisst, dass eine fesselnde Daramatik für einen großen Film unweigerlich notwendig ist.
Und so kommt man dann, irgendwann während des Betrachtens, nicht umhin, sich zu fragen, wo (zum Kuckuck!) der Film eigentlich hinwill, was er (verdammt nochmal!) eigentlich zu sagen hat.
Zudem bleibt die Andeutung, Demenz als eine Art Strafe, eine Art private Hölle anzusehen, gelinde gesagt ein insgesamt sehr heikler bis fragwürdiger Ansatz. Natürlich wird jeder Demenzkranke mehr oder weniger wehrlos von genau jenen Erinnerungen heimgesucht, die er während seines bewussten Lebens selbst erschaffen hat, diese Tatsache und damit die Krankheit insgesamt aber in einen moralisierenden Kontext zu verschieben, bleibt kritisch.
Keine Krankheit sollte, und kann schlüssig, aus der moralischen Beurteilung eines Lebens rückerklärt werden.
Insgesamt würde ich CAPONE - trotz der groben Schwächen - empfehlen wollen, jedoch nur demjenigen, der - ganz explizit - am Medium FILM oder der Krankheit DEMENZ interessiert ist. Dem Durchschnittsseher rate ich ab. Er wird mit CAPONE seine Schwierigkeiten haben.
Eine filmische Demenz???
70 %
... link
... older stories